
Blockchain in der Wirtschaftsprüfung – Chance oder Risiko?
Immer mehr Unternehmen erproben den Einsatz der Blockchain in ihren Prozessen – auch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Die Technologie verspricht mehr Transparenz und Effizienz, birgt jedoch auch Risiken. Zudem erfordert sie neue Kompetenzen bei den Prüfer*innen.
Vereinfacht gesagt, handelt es sich bei der Blockchain um eine Art digitales Notizbuch. Einträge in das Notizbuch sind nur in chronologischer Reihenfolge erlaubt und können im Nachhinein nicht mehr geändert werden. Gespeichert werden sie als unveränderliche Datenblöcke – nicht auf einer zentralen Plattform, sondern auf vielen verschiedenen Computern eines Netzwerks. Durch diese Mechanismen gelten die Informationen als transparent und fälschungssicher – einer der wesentlichen Gründe, warum vor allem Kryptowährungen auf sie setzen.
Doch die Blockchain ist längst nicht mehr nur das Spielfeld von Bitcoin, Ether & Co. So nutzen die ersten Unternehmen die Technologie für eine Vielzahl von Anwendungen. Dies kann Folgen für die Abschlussprüfung haben: Wenn beispielsweise automatisierte Zahlungsmechanismen oder andere Finanztransaktionen betroffen sind. Auch wenn Mandanten Lieferketten-Dokumentationen auf die Blockchain schieben, kann das Thema später auf den Schreibtischen der Prüfer*innen landen – als Teil des Nachhaltigkeitsreportings.
Noch spielt die Blockchain zwar nur eine marginale Rolle bei der Jahresabschlussprüfung. Doch je mehr Unternehmen die Technologie verwenden, um ihre Prozesse zu optimieren, umso entschiedener müssen sich auch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (WPG) auf die Technologie einstellen. Vor allem die größeren, internationalen WPG haben bereits Pilotprojekte gestartet, um den Umgang mit der Blockchain zu erproben und Kompetenzen bei dem Thema aufzubauen.
Schnittstellen: Welche Daten sind für die Prüfung relevant?
Nicht in jedem Bereich, in dem die Blockchain zum Einsatz kommt, wirkt sie sich auch auf die finanzielle oder nichtfinanzielle Berichterstattung aus. Schnittstellen ergeben sich aktuell hauptsächlich in folgenden Themenfeldern:
- Finanzmanagement: Wenn Guthaben, Wertpapiere, Forderungen und andere Finanzdaten des Mandanten in einer Blockchain geführt werden, sparen sich die Prüfer*innen möglicherweise eine Menge Papierkram. So ist es bei der Jahresabschlussprüfung grundsätzlich notwendig, Bestätigungsbelege für Banksalden, Verbindlichkeiten oder auch für offene Forderungen bei Banken und Geschäftspartnern einzuholen. Liegen die Informationen hingegen auf der Blockchain, könnten die Prüfer*innen gegebenenfalls künftig auf externe Bestätigungen verzichten.
- Lieferketten: Unternehmen können durch die Blockchain-Technologie die Transparenz und Verantwortlichkeiten entlang ihrer Supply-Chain verbessern. Ein- und Auslieferungsnachweise, Übergabeprotokolle, Herkunftszertifikate und dergleichen werden dabei in der Blockchain dokumentiert. Auf diese Weise kann die Einhaltung regulatorischer Anforderungen – etwa aus dem Lieferkettengesetz oder anderen ESG-Regularien – transparenter reportet werden.
- Vertragsabwicklung: Nutzen die Mandanten sogenannte „Smart Contracts“, werden Vertragspflichten wie etwa Zahlungen automatisiert ausgeführt. Hierbei wird ein Programmcode auf der Blockchain hinterlegt, der Überweisungen veranlasst, wenn bestimmte vertraglich definierte Kriterien erfüllt werden. Die Prüfer*innen müssen die Richtigkeit und Vollständigkeit solcher Transaktionen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung nachhalten. Denkbar ist, dass die hierbei gängigen Stichproben-Kontrollen durch eine automatisierte Vollprüfung der Blockchain-Daten ersetzt werden.
- Vermögenswerte als Tokens: Die Tokenisierung beschreibt die digitale Abbildung von Vermögenswerten oder Nutzungsrechten auf der Blockchain. Prüfer*innen müssen sicherstellen, dass die Bilanzierung korrekt erfolgt. Hierzu gehört unter Umständen auch die Kontrolle der realen Existenz des Vermögenswerts und die Prüfung, ob der jeweilige Token auch mit dem wahren wirtschaftlichen Wert des Assets bilanziert wurde.
Wie alle Innovationen bringt auch die Blockchain Chancen und Risiken mit sich. Blicken wir zunächst auf die positiven Aspekte. Im Anschluss analysieren wir die Herausforderungen, die sich durch die Blockchain für die Abschlussprüfung ergeben könnten.
Prüfungschancen: Transparenz, Effizienz, Bewertungsmethoden
Die wesentlichen Vorteile der Technologie für die Prüfung des Jahresabschlusses lassen sich auf drei Kernthemen herunterbrechen:
- Transparenz: Transaktionen, die auf der Blockchain gespeichert werden, können nachträglich nicht mehr geändert bzw. manipuliert werden. Zudem lässt sich in der Blockchain die komplette Transaktionshistorie eines Vorgangs nachvollziehen, es gibt also klare „Audit Trails“. Können die Prüfer*innen auf die Datenintegrität vertrauen, lassen sich darauf bezogene Qualitätskontrollen reduzieren.
- Reduzierter Abstimmungsaufwand: Die Blockchain macht viele manuelle Aufgaben wie das Einholen externer Bestätigungen und Belege überflüssig. So lassen sich Salden direkt durch einen Abgleich mit den historischen Transaktionsdaten verifizieren. Das führt zu effektiven Zeiteinsparungen und beschleunigt den Prüfungsprozess. Ein Problem bleibt: Die Prüfungsstandards erkennen die Blockchain-Verifizierung noch nicht als „Bestätigung von unabhängiger Seite“ an.
- Wirksamere Prüfungsmethoden: Die auf der Blockchain hinterlegten Daten sind grundsätzlich transparent, vollständig, aktuell und natürlich digital. Das sind beste Voraussetzungen, um eine KI-gestützte Vollprüfung der Datensätze (Full Population Testing) durchzuführen. Im Vergleich zu den üblichen Kontrollverfahren auf Stichproben-Basis sollte die Vollprüfung zu valideren Ergebnissen führen. Mit Blick auf die Zukunft wird auch über kontinuierliche Prüfungsansätze (Continuous Audit) nachgedacht. Die stichtagsbezogene Jahresabschlussprüfung könnte auf lange Sicht sogar durch ein durchgängiges prüferisches Monitoring (Real Time Audit) ersetzt oder ergänzt werden.
Prüfungsrisiken: Frühe Fehler, Datenformate, Gesetzeslücken, Quanten
Ob die Blockchain wirklich dazu beitragen kann, die Qualität des Audits zu erhöhen, hängt auch vom richtigen Umgang der Prüfer*innen mit den Herausforderungen der Technologie ab. Vier Risiken sollten sie beim Audit in jedem Fall im Blick behalten:
- Fehlerhafte Eingabedaten: Eine nachträgliche Manipulation der Informationen auf der Blockchain ist nahezu ausgeschlossen. Das bedeutet aber auch: Sind die ersten Eingabedaten bereits fehlerhaft oder gar manipuliert, dann bleiben sie es auch. Prüfer*innen sollten es immer im Hinterkopf behalten. Lassen sie sich hingegen von der hohen Datenintegrität blenden, für die die Blockchain immer wieder gefeiert wird, besteht das Risiko, dass sie die Eingangsdaten nur nachlässig kontrollieren.
- Heterogene Standards: „Die“ Blockchain gibt es nicht. Stattdessen erschwert eine unüberschaubare Vielzahl von Blockchain-Protokollen den Prüfungsprozess. Die Analysesoftware der Prüfer*innen sollte daher in der Lage sein, unterschiedliche Datenformate auszulesen und zu interpretieren.
- Rechtliche Unsicherheit: Noch fehlt es an einem verbindlichen rechtlichen Rahmen für die Blockchain-Technologie. Datenschutz, Haftung, Beweiswert in Gerichtsfällen – viele juristische Themen bleiben ungeklärt. Der im September 2025 in Kraft getretene EU Data Act befasst sich zwar explizit mit den Smart Contracts – viele juristische Fragen hierzu bleiben dennoch ungeklärt. Die Durchführung eines „Smart Contract Audits“ kann sinnvoll für eine ungefähre rechtliche Standortbestimmung sein.
- Externe Bedrohungen: Die Daten auf der Blockchain gelten als sicher – und doch gibt es theoretische Risiken. Übernimmt ein Angreifer beispielsweise mehr als 50 Prozent der Rechenleistung eines Blockchain-Netzwerks, ist es ihm möglich, Transaktionsdaten zu manipulieren. Auch die Rechenpower von Quantencomputern könnte einmal eine Bedrohung darstellen.
Fazit: Die Chancen überwiegen die Risiken
Durch die Blockchain lassen sich Prozesse verschlanken und neue Businessmodelle entwickeln. Die Technologie dürfte daher nach und nach in zahlreiche Branchen und Geschäftsbereiche einziehen. Verschieben die Mandanten prüfungsrelevante Prozesse auf die Blockchain, muss auch die Jahresabschlussprüfung – zumindest partiell – auf der Basis der Technologie erfolgen. Es ist notwendig, Investitionen in Technologie frühzeitig und mit Weitblick zu tätigen. Mitarbeiter*innen müssen aus den gleichen Gründen mit ausreichend zeitlichem Vorlauf geschult werden. Stimmt das Timing am Ende des Tages, dann spricht in der Prüfungsbranche vieles dafür, dass die Chancen der Blockchain die Risiken überwiegen.
Für weitere Themen rund um die Wirtschaftsprüfung und Forvis Mazars folgen Sie uns auch auf LinkedIn.








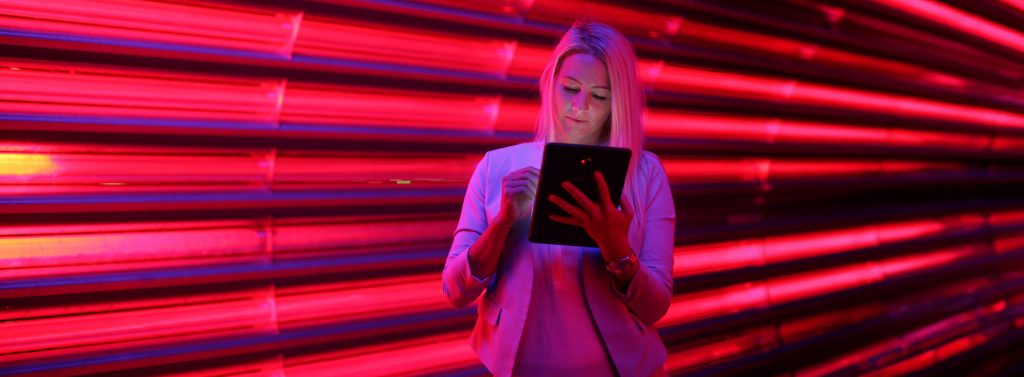



Kommentare