
Fake News: Herausforderung für Wirtschaft und Prüfungspraxis
Sie manipulieren Börsenkurse und bedrohen die Reputation integrer Unternehmen – Fake News sind in der Wirtschaft kaum mehr wegzudenken. Längst beeinflussen sie sogar Finanzberichte und Abschlussprüfungen. Kann man den Geist zurück in die Flasche bringen? Zumindest das Risiko ließe sich eindämmen – mit dem Know-how der Wirtschaftsprüfer*innen.
Falschmeldungen waren schon immer in der Lage, die Kurse an den Börsen zu bewegen – doch nie hatten ihre Absender damit ein so leichtes Spiel wie heute. Erst im April dieses Jahres sorgte ein angebliches Statement von US-Präsident Donald Trump innerhalb von Minuten für einen Kurssprung an der Börse: Befeuert durch die Meldung, es solle ein Moratorium seiner Strafzölle geben, stieg der S&P-Aktienindex um fast 6 Prozent. Doch die Meldung war Fake News. Als das klar wurde, ging es im gleichen Tempo wieder abwärts an der Wall Street. 2,4 Billionen Dollar wurden so erst geschaffen und kurz darauf wieder vernichtet. Auch einzelne Unternehmen können in das Visier der Fake-News-Trolle geraten. Eine Lektion, die Intel bereits vor zehn Jahren lernen musste: Eine gefälschte Pressemitteilung behauptete damals, der Chiphersteller wolle aus einem sechs Milliarden Dollar schweren Investment in Israel aussteigen. Mit den Tatsachen hatte das nichts zu tun – den Vorstand brachte das Ganze dennoch in Erklärungsnot.
Nicht immer müssen sich Firmenchefs auf offener Bühne gegen die falschen Beschuldigungen wehren. Der überwiegende Teil der Geschichten mit doppeltem Boden wird nicht an die große Glocke gehängt. Wie viele Unternehmen sich im Stillen damit auseinandersetzen, bleibt daher unklar. Sicher ist: Es werden immer mehr. Gründe gibt es viele: die fragmentierte Medienlandschaft, die rasante Entwicklung und Verbreitung der Sozialen Medien, der Einsatz von Bots und mittlerweile auch von Künstlicher Intelligenz. Bereits 2018 belegte das Massachusetts Institute of Technology (MIT) zudem in einer Studie, dass Fake News bis zu sechsmal häufiger geteilt werden als Tatsachen-Meldungen. Als einen der Gründe dafür führten die Forscher*innen die überraschenderen Inhalte der ausgedachten Nachrichten an. Es ist also nicht die Technik allein, welche die Entwicklung treibt, es ist auch die menschliche Sensationslust.
Risikofaktoren: Warum Onlinepräsenz und Integrität gefährlich sind
Die Lust der einen ist das Leid der anderen. Vor allem für betroffene Unternehmen steht oft viel auf dem Spiel. So kann das Firmenimage durch anhaltende Falschinformationen einen dauerhaften Schaden davontragen. Die möglichen Folgen: Mitarbeiter*innen kündigen, Kund*innen greifen zu alternativen Produkten oder nutzen andere Dienstleistungen, Geschäftspartner*innen überdenken ihre Zusammenarbeit. Vor allem Unternehmen, deren Markenwert auf Vertrauen und Integrität basiert, haben viel durch die Rufschädigung im Netz zu verlieren. Ihr Risiko steigt, wenn sie selbst stark im digitalen Raum präsent sind. Denn die gleichen Sozialen Medien und Portale, die das Unternehmen bisher so erfolgreich bei der Stakeholder-Kommunikation nutzt, können von Cyberkriminellen missbraucht werden, um es zu diskreditieren. Auch wenn das Unternehmen die Vorwürfe entkräftet – die Reputation ist nie so schnell wieder hergestellt, wie sie zuvor verloren ging. Medienmanager wissen seither: Gute Nachrichten steigern die Auflage nur in seltenen Fällen. „Bad news is good news“ lautet stattdessen das erste Gesetz der Aufmerksamkeitsökonomie.
Die Motive für das Spiel mit den verdrehten Tatsachen sind vielfältig. In einem aktuellen Positionspapier zum Thema „Fake News“ führt das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) daher eine beachtliche Bandbreite von Personengruppen an, die als Absender falscher Storys in Frage kommen. Oft stehen demnach politische Aktivist*innen hinter den Kampagnen, manchmal anonyme Trolle, es können aber auch Kriminelle sein oder schlicht die Konkurrenz, die sich Marktvorteile durch den Schaden ihres Wettbewerbers erhofft. Tauchen vermehrt negative Kommentare auf Arbeitgeberbewertungsseiten im Internet auf, ist die Vermutung nicht weit, dass enttäuschte Ex-Mitarbeiter*innen dahinterstecken könnten.
Jahresabschlussbericht: Wie bucht man Imageschäden?
Wird ein Unternehmen zum Zielobjekt einer langanhaltenden, rufschädigenden Fake-News-Kampagne, bleibt das in der Regel nicht ohne Auswirkung auf die Finanzberichterstattung. Denn der Vertrauensverlust bei Kund*innen, Investoren und Geschäftspartner*innen übersetzt sich oftmals in Umsatzeinbußen und rückläufige Marktanteile. Gleichzeitig entstehen Ausgaben durch eingeleitete Abwehrmaßnahmen – etwa für Krisenkommunikation, Rechtsberatung oder durch das Engagement von Cybercrime-Expert*innen. Kosten wie diese sind in der Gewinn- und Verlustrechnung als „sonstige betriebliche Aufwendungen“ zu verbuchen.
Im Lagebericht informieren die Unternehmen über absehbare Risiken, die den Geschäftsverlauf, das Ergebnis oder die Vermögenslage zukünftig wesentlich beeinflussen könnten. Dazu können auch durch Fake News verursachte Reputations- oder Marktwertschäden gezählt werden, sofern sie als wesentlich einzustufen sind. Doch wann fällt ein Risiko in die Kategorie „wesentlich“ und wann nicht? Um das zu bestimmen, müssen die Unternehmen zunächst das potenzielle Schadensausmaß abschätzen, welches das Risiko mit sich bringt – und zwar im Hinblick auf künftig zu erwartende Gewinn- oder Umsatzrückgänge. Das Schadensausmaß muss anschließend ins Verhältnis zu seiner Eintrittswahrscheinlichkeit gesetzt werden. Ein Reputationsrisiko mit hohen finanziellen Folgen ist also nur dann ein berichtspflichtiges Risiko, wenn beispielsweise kritische Medienbeiträge oder bereits erfolgte bzw. angekündigte Cyberangriffe es auch als realistisches Szenario erscheinen lassen.
Abschlussprüfung: Digitale Medienanalyse für den besseren Überblick
Wirtschaftsprüfer*innen bewerten, ob die Fake-Kampagnen, denen der Mandant ausgesetzt war bzw. zukünftig sein könnte, korrekt und vollständig vom Abschlussbericht abgebildet werden. Die Autor*innen des IDW-Papers heben in diesem Zusammenhang hervor, dass es hilfreich sein kann, wenn sich die Prüfer*innen zunächst ein Bild über das digitale Umfeld machen, in dem der Mandant agiert. Wie oben erwähnt, steigt die Vulnerabilität der Unternehmen, wenn diese bei der Stakeholder-Kommunikation selbst stark auf Social Media und andere Onlineplattformen setzen. Die Prüfer*innen sollten daher wissen, auf welchen Kanälen der Mandant präsent ist und welche Botschaften dort über ihn verbreitet werden. Zeigt sich, dass der Mandant bereits Opfer eines Fake-News-Angriffs geworden ist, müssen sich die Prüfer*innen ein detailliertes Verständnis der Schmähkampagne erarbeiten. Nur so können sie beurteilen, ob ihr Mandant diesen Angriff korrekt und vollständig im Abschluss reportet hat.
Anti-Fake-Expertise: Mehrwert durch Wirtschaftsprüfer*innen?
Für die Unternehmensberatung Gartner gehört Desinformationssicherheit zu den technologischen Top-Trends des Jahres 2025. Und es spricht vieles dafür, dass sich das Thema auf absehbare Zeit in diesem Ranking halten kann. Denn die Cyberattacken werden durch die Weiterentwicklung von KI-Tools in Zukunft voraussichtlich weiter zunehmen – und in der Folge der Bedarf der Unternehmen an Gegenmaßnahmen. Für eine signifikante Risikominimierung reicht es allerdings nicht aus, nur eben schnell eine neue Sicherheits-App auf den Unternehmensrechnern zu installieren. Um sich gezielt vor Fake News zu schützen, müssen die Abwehrmechanismen mit den internen Unternehmensprozessen verzahnt werden. Gefragt sind deshalb Expert*innen, die nicht nur mit den Abläufen im jeweiligen Unternehmen vertraut sind, sondern auch etwas von Compliance- und Risikomanagement verstehen, und die wissen, auf was es bei Kontrollsystemen ankommt.
Es scheint ein Aufgabenprofil wie gemacht für Wirtschaftsprüfer*innen zu sein: Sie kennen nicht nur die internen Abläufe ihrer Mandanten, sie bringen auch die nötige Expertise mit, die es für den Job braucht. In ihrer Rolle als Berater*innen können sie ihre Mandanten daher unter anderem bei der Formulierung einer umfassenden Sicherheitsstrategie unterstützen und helfen ihnen beim Implementieren der passenden Tools, inklusive geeigneter Monitoring- und Kontrollsysteme. Aus Sicht des IDW bringen die Prüfer*innen ihre Kompetenzen in vier wesentlichen Bereichen ein:
- Technikauswahl und Implementierung: Support bei Auswahl, Einführung und Betrieb von Tools zur Fake-News-Erkennung.
- Monitoring- und Frühwarnsysteme: Einrichtung von Prozessen zur Medienbeobachtung, Entwicklung von Krisenplänen, inklusive Krisenkommunikation.
- Simulation und Stresstests: Durchspielen eines fiktiven Fake-News-Angriffs mit dem Management, um Abläufe für den Ernstfall einzuüben.
- Analyse und Aufklärung: Ermittlung der Hintermänner von Cyberangriffen durch die hochentwickelten Datenforensik-Systeme der Wirtschaftsprüfung. Analyse der Auswirkungen von Angriffen auf den Jahresabschluss.
Fazit: Gegen Fake News helfen nur reale Abwehrmaßnahmen
Es ist mit Social Media und KI wie mit jeder neuen Technik: Richtig eingesetzt, bringen sie zahlreiche Vorteile mit sich und bereichern viele Aspekte des beruflichen und privaten Lebens. Aber sie haben auch ihre Schattenseiten – die Verbreitung von Fake News ist eine davon. Die Schmähkampagnen verunsichern die Märkte, zerstören die Reputation integrer Unternehmen und formulieren neue Herausforderungen für den Jahresabschluss und die Abschlussprüfung. Moderne Schutz- und Monitoringsysteme minimieren das Risiko der Unternehmen, in den Strudel der Desinformationsflut zu geraten. Wirtschaftsprüfer*innen unterstützen ihre Mandanten bei Implementierung und Betrieb entsprechender Lösungen. Und sie setzen ihre innovativen Datenforensik-Tools aus der Wirtschaftsprüfung ein, um bei bestehenden Fake-News-Angriffen die Übeltäter ausfindig zu machen. Das Fake-News-Risiko ist damit nicht gebannt, aber es wird beherrschbarer gemacht.
Für weitere Themen rund um die Wirtschaftsprüfung und Forvis Mazars folgen Sie uns auch auf LinkedIn.







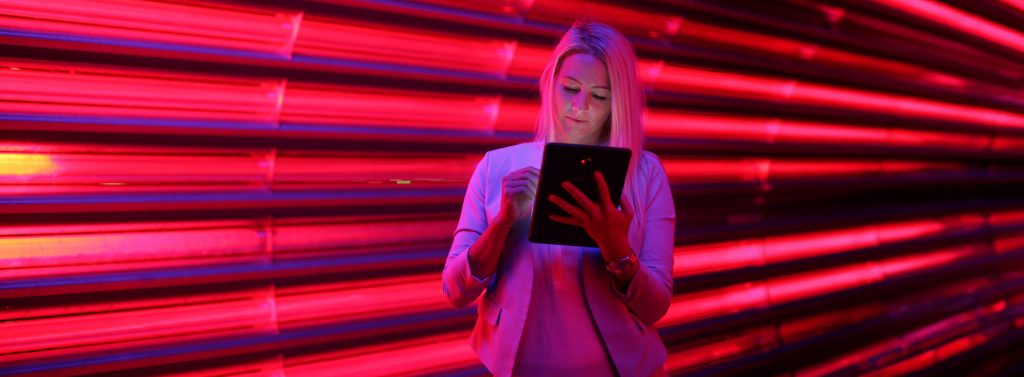



Kommentare